Journalismus für eine neue Generation
Die Holtzbrinck-Schule für Journalismus bildet seit 1988 Volontärinnen und Volontäre zu Redakteurinnen und Redakteuren aus. Die Schule ist die zentrale Ausbildungsstätte für den journalistischen Nachwuchs von Tagesspiegel, Zeit Online, WirtschaftsWoche und Handelsblatt. Die inzwischen mehr als 400 Absolventinnen und Absolventen arbeiten in nahezu allen relevanten Redaktionen des Landes, teilweise in führenden Positionen.

„Die Zukunft gehört denen, die sich in Bewegung gesetzt haben – auch im Journalismus.“
Dieter von Holtzbrinck
Verleger
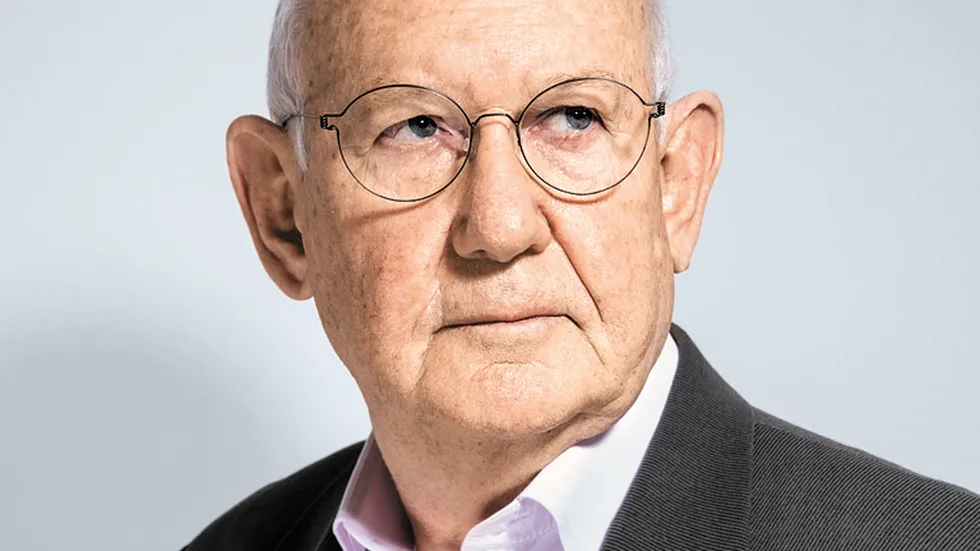
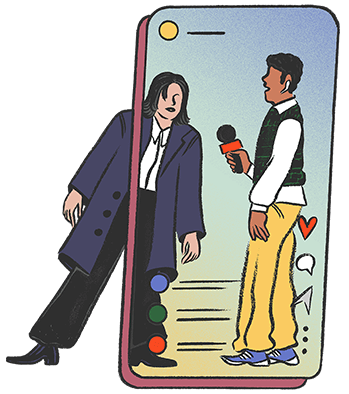
Wer wir sind
Wichtigste Aufgabe der Holtzbrinck-Schule ist die Ausbildung von Volontärinnen und Volontären zu Qualitätsjournalisten. Neben dem klassischen journalistischen Handwerk sind im Curriculum der Schule alle relevanten digitalen Disziplinen wie Datenjournalismus, Storytelling, Künstliche Intelligenz, aber auch Podcast- und Videoproduktion fest verankert. Dazu kommen Ausbildungsmodule, die den angehenden Journalistinnen und Journalisten zeigen, wie ein modernes (digitales) Verlagshaus funktioniert, wie neue Produkte entstehen, wie sich Kunden- und Lesedaten gewinnbringend analysieren lassen und wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz den Journalismus verändern wird. Mehr als ein Dutzend erfahrene externe und interne Dozentinnen und Dozenten vermitteln die Lehrinhalte.
Neben dem Unterricht in der Journalistenschule arbeiten die Volontärinnen und Volontäre äußerst praxisnah in den vier Redaktionen mit und lernen dort alle im Alltag relevanten Abläufe kennen. Das Recherchieren und Publizieren eigener Beiträge steht dabei im Mittelpunkt und wird von erfahrenen Redakteurinnen und Redakteuren begleitet.
Schulleitung

Peter Brors
Peter Brors leitet seit August 2013 die Holtzbrinck-Schule für Journalismus. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium hat er selbst die Holtzbrinck-Schule durchlaufen. Von 1995 an arbeitete Brors zunächst als Redakteur und Reporter, später als Chefreporter beim Handelsblatt. 2007 ging er als Korrespondent zum Manager Magazin, ehe er 2008 als stellvertretender Chefredakteur zum Handelsblatt zurückkehrte. Seit Mai 2013 war Peter Brors neben seiner Funktion als Schulleiter auch als Personalchef der Handelsblatt Media Group tätig. Im Mai 2016 wechselte er als stellvertretender Chefredakteur zurück in die Handelsblatt Redaktion.

Stephanie Fasselt
Stephanie Fasselt ist Referentin der Journalistenschule. Nach Abschluss ihres Betriebswirtschaftsstudium startete sie 2011 bei der Handelsblatt Media Group. Nach verschiedenen Positionen innerhalb der Gruppe, ist sie seit Januar 2024 Teil der Holtzbrinck-Schule für Journalismus.
Häufig gestellte Fragen von Bewerbern
Werden die Schülerinnen und Schüler entlohnt?
Muss von der Entlohnung Schulgeld entrichtet werden?
Für welche Redaktionen bildet die Schule den journalistischen Nachwuchs aus?
Die Holtzbrinck-Schule dient den Volontärinnen und Volontäre von Tagesspiegel, Zeit Online, WirtschaftsWoche und Handelsblatt als zentrale Ausbildungsstätte. Die Schüler erhalten jeweils bei einer der Redaktionen einen Ausbildungsvertrag und werden zu den Schulwochen nach Düsseldorf entsandt. Jede Bewerberin und jeder Bewerber sollte bei Beginn des Auswahlverfahrens eine der vier Redaktionen als seine bevorzugte Ausbildungsstelle (Stammredaktion) benennen.
Wie lange dauert das Volontariat?
Wann und wie oft werden neue Schülerinnen und Schüler eingestellt?
Ist ein abgeschlossenes Studium Voraussetzung für den Besuch der Schule?
Gibt es eine Altersbegrenzung?
Kann ich mich mehrfach bewerben?
Kein Problem. Einige Schülerinnen und Schüler haben es in der Vergangenheit erst im zweiten Anlauf geschafft und haben dennoch anschließend bemerkenswerte Karrieren folgen lassen.
In wie vielen Redaktionen absolvieren die Volontärinnen und Volontäre ihre Praktika?
Die Ausbildung umfasst mehrere Praktika außerhalb der eigentlichen Stammredaktion. So verbringt jede Volontärin und jeder Volontär auch mehrere Wochen bei den anderen Trägerredaktionen der Schule, also bei Tagesspiegel, Zeit Online, WirtschaftsWoche und Handelsblatt.
Was kommt nach der Ausbildung?
Was tut die Schule für Diversität?
Wir haben keine Quoten, für nichts: nicht für Geschlecht, Herkunft, Religion, sozioökonomische Verhältnisse, Gesinnung, sexuelle Identität. Wir erheben diese Merkmale nicht – und ermutigen ausdrücklich Menschen jeglicher Identität, sich zu bewerben.
Seit wann gibt es die Journalistenschule?
Die Schule wurde in den 1980er Jahren von Verleger Dieter von Holtzbrinck und dem Journalismus-Professor Ferdinand Simoneit gegründet. Seither haben viele hundert Volontärinnen und Volontäre die Schule absolviert. Sie arbeiten heute nahezu in allen relevanten Medien Deutschlands.
